>>> zur Überblicksseite Proseminararbeiten
Seminararbeit in „Erwachsenenbildung und Sozialarbeit“
Autor: Wolfgang Starzinger
Wintersemester 2008/09 Wien, 9. Februar 2009
FH Campus Wien, Soziale Arbeit Politische Beteiligung und informelles Lernen
Erwachsenenbildung Wolfgang Starzinger
LV-Leiter: DSA MAS Manfred Schindler 3. Semester BA VZ
Einleitung
Diese Seminararbeit wird für die Lehrveranstaltung Erwachsenenbildung verfasst. Die Arbeit mit dem Titel „Politische Beteiligung und informelles Lernen“ steht im Rahmen des Themengebietes unübliche Bildungseinrichtungen.
Ich versuche zu Beginn zu klären was unter informellem Lernen zu verstehen ist und wie es von formalem Lernen abgegrenzt werden kann. Danach versuche ich auf das Feld von politischer Partizipation und darin enthaltenen Aspekten von informellem Lernen einzugehen. Als Literaturgrundlage dienen mir ein Gespräch zwischen Elke Gruber, Manfred Schindler und Peter Bettelheim mit dem Titel „,Planungszelle versus Zukunftswerkstatt’ oder ist ,Politische Bildung’ politisch?“ und die Bücher „Die Planungszelle. Der Bürger plant seine Umwelt. Eine Alternative zur Establishment-Demokratie“ von Peter C. Dienel aus dem Jahr 1991 und „Zukunftswerkstätten“ von Robert Jungk im Jahr 1981 verfasst.
1.1. Informelles Lernen
Zuerst gilt es einmal abzuklären, was unter nicht-formalem bzw. informellem Lernen im Gegensatz zum formalen Lernen zu verstehen ist. Unter anderem fasste die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in ihrem Arbeitsdokument der Kommissionsstellen mit dem Titel „Memorandum über Lebenslanges Lernen“, das im Jahr 2000 erarbeitet wurde, diese drei Kategorien von Lernen wie folgt zusammen :
Formales Lernen findet in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen statt und führt zu anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen.
Nicht-formales Lernen findet außerhalb der Hauptsysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung statt und führt nicht unbedingt zum Erwerb eines formalen Abschlusses. Nicht-formales kann am Arbeitsplatz und im Rahmen von Aktivitäten der Organisationen und Gruppierungen der Zivilgesellschaft (wie Jugendorganisationen, Gewerkschaften und politischen Parteien) stattfinden. Auch Organisationen oder Dienste, die zur Ergänzung der formalen Systeme eingerichtet werden, können als Ort nicht-formalen Lernens fungieren (z.B. Kunst-, Musik- und Sportkurse oder private Betreuung durch Tutoren zur Prüfungsvorbereitung).
Informelles Lernen ist eine natürliche Begleiterscheinung des täglichen Lebens. Anders als beim formalen und nicht-formalen Lernen handelt es sich beim informellen Lernen nicht notwendigerweise um ein intentionales Lernen, weshalb es auch von den Lernenden selbst unter Umständen gar nicht als Erweiterung ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten wahrgenommen wird (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2000: 9f).
Informelles Lernen kennt also keinen klaren Rahmen. Dies kann positiv gedeutet werden, in dem Sinne, dass es quasi immer und überall stattfinden kann und auch tatsächlich stattfindet. Da es recht ungezwungen ablaufen kann und keine klaren Zielvorgaben haben muss, ist es aber auch schwer fassbar oder gar messbar und bewertbar zu machen. Gerade diese Unrationalität des informellen Lernens sehen beispielsweise die Institutionen der EU als problematisch an und versuchen nun, wie auch aus dem oben zitierten „Memorandum über Lebenslanges Lernen“ hervorgeht, es einzuordnen und zu strukturieren. Informelles Lernen soll also systematisch nutzbar und gezielt anwendbar gemacht werden.
Gerade in dem Irrationalen, dem Unplanbaren und dem Ungezwungenen kann aber genau der Vorteil bzw. das Besondere des informellen Lernens gesehen werden.
1.1. Unübliche Einrichtungen der Bildung
Als nächstes möchte ich nun auf einige unübliche Einrichtungen der Bildung eingehen. Dazu möchte ich festhalten, dass ich den Begriff „Einrichtung“ möglichst offen halte. Einrichtung ist also nicht unbedingt als Organisation oder Institution zu sehen und auch nicht räumlich fest zu machen. Im Prinzip kann alles, was nicht als Bildungseinrichtung definiert ist, als unübliche Einrichtung der Bildung betrachtet werden. Herkömmliche Einrichtungen der Bildung sind Schulen, Universitäten oder andere Ausbildungsstätten, die Hauptziel die Weitergabe von Wissen und klar definierten fachlichen Fähigkeiten haben.
Vereine haben meist ein konkretes Ziel, ein Anliegen. In Sportvereinen zum Beispiel organisieren sich Menschen um Möglichkeiten zu schaffen eine oder mehrere Sportarten auszuüben. Es bedarf dafür eines organisatorischen Aufwandes, etwa, wenn es darum geht Trainingsplätze zur Verfügung zu haben, es bedarf eines finanziellen Aufwandes, wenn zum Beispiel spezielle Ausrüstung für die Ausübung des Sports notwendig ist. Vereine vernetzen sich untereinander, Wettkämpfe und Meisterschaften werden organisiert und vieles mehr. Außerdem sind die meisten SportlerInnen bestrebt bestimmte Leistungen zu erzielen, sich selbst zu verbessern. Beim Zusammenschluss oder beim Beitritt zu einem Sportverein ist das voneinander Lernen ein entscheidender Punkt. TrainerInnen sind speziell ausgebildet, KollegInnen geben sich gegenseitig Tipps. Dabei ist das Lernen, zumeist kombiniert mit Übungen, recht konkret und das definierte Ziel. Immer öfter wird aber gerade auch im Bezug auf Sportvereine, oder viele andere Freizeitvereinigungen wie Musikvereine und vieles mehr, ein sozialer Lerneffekt betont. Vor allem Kinder und Jugendliche sollen in Vereinen das Zusammenleben „erlernen“ und sich so dann allgemein in der Gesellschaft besser zurechtfinden . Hierfür gibt es aber in den seltensten Fällen speziell ausgebildete Trainer oder Übungen. Dieses Lernen läuft also informell ab, es ist eben nicht konkret fassbar und messbar. Es läuft permanent im wahrsten Sinne des Wortes zwischenmenschlich ab. (vgl. Wien Marketing GmbH (2003): Wien. Zukunft findet Stadt. Bewegung findet Stadt. Dachverbände).
2. Politische Beteiligung
Politische Aktivität von BürgerInnen hat zumeist Elemente des informellen und des Nicht-formalen Lernens. Wobei ich in dieser Arbeit keine genaue Kategorisierung vornehme, in welches der beiden Modelle welcher Bildungseffekt einzuordnen ist.
Ausgehend davon, dass BürgerInnen ein bestimmtes Anliegen haben, organisieren sie sich im Bestreben ein Ziel zu erreichen. Dabei erlernen, übern und praktizieren die beteiligten Menschen beispielsweise Organisieren und Vernetzen, Beschaffung und Verarbeitung von Informationen. Es geht darum den Blick in die Zukunft zu schärfen, bestimmte Vorgehensweisen abzuschätzen und danach zu reflektieren und zu analysieren. Die Gruppe muss sich mit GegnerInnen auseinandersetzen und diesen begegnen. Es gilt Konflikte innerhalb der Gruppe zu bearbeiten. Oft ist es auch notwendig mit einer neutralen Öffentlichkeit zu kommunizieren oder diese für das eigene Anliegen zu gewinnen. Es kann aber ebenfalls sein, dass sich die Gruppe nicht durchsetzt. Es muss die Niederlage eingestanden und neue Sichtweisen akzeptiert werden.
Dies sind alles Kompetenzen, die natürlich nicht nur über politische Beteiligung, erworben werden können. Es legt aber dar, dass politische Beteiligung, nicht einfach nur den Effekt hat, dass ein persönliches politisches Ziel durchgesetzt wird, sondern, dass auch ein gewisser „bildender Mehrwert“ daraus erwächst. Elke Gruber listet in ihrem Text „Politische Bildung und Erwachsenenbildung – ein pädagogisch-struktureller Blick“ ähnliche Fähigkeiten auf. Sie bescheinigt politischer Bildung die Fähigkeit diese Kompetenzen zu vermitteln (vgl. Gruber 2008: 288). Aktive politische Beteiligung hat gegenüber der institutionellen politischen Bildung den zusätzlichen Vorteil, dass sie eine praktische, tatsächlich zu erlebende Erfahrung bietet. Mehrwert wird durch soziale Interaktion gewonnen. Dieser liegt dann aber nicht nur im Feld politischer Beteiligung, Politik und Gesellschaft. Zusätzlich können bei aktiver politischer Beteiligung Potenziale der Kreativität und des Engagements geweckt werden. Nach diesen allgemeinen Ausführungen zur politischen Beteiligung und informellem Lernen möchte ich nun auf zwei Möglichkeiten der Beteiligung eingehen.
2.1. Planungszelle und Zukunftswerkstatt
Als Beispiele für Modelle der politischen Beteiligung stelle ich die Planungszelle und die Zukunftswerkstatt in Grundzügen vor. Im darauf folgenden Kapitel werde ich dann anhand eines Gesprächs zwischen Peter Bettelheim, Elke Gruber und Manfred Schindler, in dem es um eben dieses Thema geht, auf Bildungseffekte der Modelle Planungszelle und Zukunftswerkstatt eingehen.
Sowohl Planungszelle als auch Zukunftswerkstatt „verstehen sich nicht als ‚Basisbewegung‘ im Sinne von Bürgerinitiativen, sondern als organisierte ‚Planungsinstrumente‘.“ Dienel, der als Erfinder der Planungszelle gilt, hat diese als notwendige „Alternative zur Establishment-Demokratie“ bezeichnet (campus.vhs.at 2000: Planungszelle versus Zukunftswerkstatt).
2.1.1. Die Planungszelle
Schon in den 1970ern schien die repräsentative Demokratie in Westeuropa von Innen wie von Außen angreifbar zu sein und Anzeichen für eine Krise oder gar dem Ende des Systems wurden gesehen und analysiert. Aus der Sicht der BürgerInnen war der Mangel an tatsächlichen Mitsprachemöglichkeiten ein Hauptproblem. Entscheidungen über das gesellschaftliche Zusammenleben werden getroffen ohne die Betroffenen selbst einzubeziehen. Bestehende Konzepte der BürgerInnenbeteiligung wurden hinterfragt, auf Mängel und Erweiterungsmöglichkeiten untersucht. Als entscheidender Mangel wurde erkannt, dass die Übernahme von Ideen aus vorhandenen Beteiligungskonzepten in die politische oder administrative Praxis mehr oder weniger dem Zufall überlassen war (vgl. Dienel 1991: 15ff).
Das Merkmal, das die Planungszelle von anderen Methoden der BürgerInnenbeteiligung unterscheidet ist der höhere Grad an Verbindlichkeit der Ergebnisse für die AuftraggeberInnen bzw. politische Institutionen. Dies hebt das Ausmaß der Mitbestimmung auf ein anderes Niveau. Dem Problem, dass sich interessierte und aktive BügerInnen in welcher Phase und auf welche Weise auch immer bei Planungsprozessen einbringen, ihre Vorschläge und Ideen, ja nicht einmal mit Aufwand von Zeit und Mühe erarbeitete Konzepte Beachtung fanden, sollte damit begegnet werden. Unverbindliche Beteiligungsverfahren dienen allzu oft nur als Feigenblatt um zu beweisen, dass das Projekt nahe an den Interessen der Betroffenen sei. Beteiligte BürgerInnen erleben diese Pseudobeteiligung als besonders enttäuschend. Dienel spricht von „unerheblichem Dabeisein“ (vgl. Dienel 1991: 10ff).
Dienel beschreibt die Planungszelle als „eine Gruppe von Bürgern (sic!), die nach Zufallsverfahren ausgewählt und für begrenzte Zeit von ihren arbeitstäglichen Verpflichtungen vergütet freigestellt worden sind, um assistiert von Prozessbegleitern (sic!), Lösungen für vorgegebene, lösbare Planungsprobleme zu erarbeiten“ (Dienel 1991: 74). Die Gruppe umfasst normalerweise rund 25 Personen, die durch (zwei) MitarbeiterInnen der Fachressorts und (zwei) ProzessbeleiterInnen ergänzt wird. Die Zusammenarbeit kann sich über wenige Tage oder auch über mehrere Wochen erstrecken.
Das Alltagswissen von Betroffenen und das Fachwissen von ExpertInnen sollen sich ergänzen. In der öffentlichen Meinung, der Einschätzung von EntscheidungsträgerInnen und Fachleuten wird das Wissen von „Laien“ oft als nicht ausreichend betrachtet. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass das vorhandene Alltagswissen je nach Anzahl der eingebundenen BürgerInnen breit ist. Es bildet eine gute Basis um sich in spezielle Themenstellungen rasch einzuarbeiten. Dafür müssen benötigte Informationen nur vollständig und gut aufbereitet sein (vgl. partizipation.at o. J.: Planungszelle). Planungszellen sind kostenintensiv. Das Einbeziehen von ExpertInnen und der breiten Bevölkerung kostet mehr als, wenn nur Fachgutachten eingeholt werden und gar nicht oder unabhängig davon BürgerInnen ein Projekt bearbeiten. Diese Mehrkosten und der aufwendigere Prozess sollten aber mehr Nachhaltigkeit, breitere Akzeptanz und umfassender konzipierte Projekte garantieren. Allerdings birgt diese Form der Partizipation durch die Abhängigkeit von GeldgeberInnen auch Gefahren wie die von Manipulation (vgl. Dienel 1991: 10ff).
Am Ende werden die Ergebnisse in einem Bürgergutachten zusammengefasst. Dieses wird dann den AuftraggeberInnen übergeben (vgl. partizipation.at o. J.: Planungszelle).
2.1.2. Die Zukunftswerkstatt
Ausgehend vom Problem, dass zwar BürgerInnen bei Entscheidungen über Alltags- und Berufsleben beteiligt werden, dies aber zumeist zu spät erfolgt, wurde die Idee der Zukunftswerkstatt geboren. Mit zu spät ist gemeint, dass die Betroffenen selbst erst dann Projekte kennenlernen und beurteilen können, wenn diese schon relativ weit fortgeschritten sind. Ohne tatsächlicher, aktiver Beteiligung der Öffentlichkeit, die die eigenen Wünsche und Vorstellungen nicht einbringen kann oder gar nicht angehalten ist welche zu entwickeln, bestimmen Fachleute und Financiers. Es gibt also eine Elite, die geleitet von eigenen Wertvorstellungen und Interessen die Zukunft vieler im Großen wie im Kleinen auf oft viele Jahre oder gar Jahrzehnte im Voraus plant. Und dies hat Auswirkungen auf praktisch alle Bereichen des Lebens. Genau diese Passivität und dieses Verplant haben auch soziale und politische Wirkung. BürgerInnen fühlen sich machtlos, stehen Fachleuten als Unwissende gegenüber und fügen sich in Vorgaben ein, egal ob es um die Planung von Wohnraum oder Stadtteilen geht, ob es um Mitsprache bei wirtschaftlichen Entscheidungen oder politischen Diskurs geht. Robert Jungk und Norbert R. Müllert sprechen von eine „Lücke im demokratischen System“, die auch zur Folge hat, dass Betroffene nicht grundsätzlich hinter dem Projekt stehen, es nicht als ihres betrachten und erst von der Notwendigkeit und Nützlichkeit überzeugt werden müssen (vgl. Jungk/Müllert 1981: 15ff).
Das Konzept der Zukunftswerkstatt soll die BügerInnen tatsächlich miteinbeziehen, deren Kreativität fördern und fordern um tatsächlich eigene Vorschläge zu bringen und so eigene Vorstellungen abseits von ExpertInnenmeinungen verwirklichen zu können. Eingeteilt wird eine Zukunftswerkstatt in folgende Phasen. Nachdem das Thema feststeht wird, wird in der Vorbereitungsphase ein geeigneter Platz gesucht, benötigte Materialien organisiert und BürgerInnen informiert und eingeladen. In der Werkstatt selbst werden zuerst nur Kritik gesammelt und Probleme dargestellt. In der Phantasiephase sollen möglichst offen, durchaus auch utopisch der Kreativität freier Lauf gelassen werden. Schließlich wird versucht die frei entwickelten Ideen in der Verwirklichungsphase in die Realität zu holen. Einschränkende Rahmenbedingungen, herrschende Machtverhältnisse und ähnliches werden bewusst erst am Ende miteinbezogen, damit sie vorher das Denken der PlanerInnen nicht blockieren (vgl. Jungk/Müllert 1981: 20f).
Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es die Zukunftsforschung. Ausgehend von den militärischen Think Tanks soll Zukunft strategisch geplant werden. Ideenfindung wird verwissenschaftlicht. Kreativität und Phantasie soll kanalisiert und gesteuert werden. In den 1960er Jahren begann die noch junge Zukunftsforschung, die sich bis dahin fast ausschließlich der Prognose von Wissenschaft und Technik gewidmet hatte, auch notwendigen gesellschaftlichen Neuerungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Obwohl die Stimmung gegen eine „Kolonisierung der Zukunft“ war, herrscht zugleich die Meinung vor, dass die „Erfindung alternativer Zukünfte“ von intellektuellen Eliten ausgehen muss (vgl. Jungk/Müllert 1981: 35f). Auf der Idee der Zukunftsforschung aufbauend wurde zuerst in den USA in den 1970ern versucht in den so genannten „Jahr 2000 Gruppen“ eine breitere Öffentlichkeit in den Prozess miteinzubeziehen. Obwohl von den politischen Eliten mitiniziert, sahen diese die Gruppen bald als eine Art Konkurrenz zur etablierten repräsentativen Demokratie (vgl. Jungk/Müllert 1981: 33ff).
2.2. Bildungseffekte der beiden Modelle
Elke Gruber sieht schon im Hintergrund der Zukunftswerkstatt ein Umdenken in der Erwachsenenpädagogik seit dem Ende der 1960er Jahre. Themenorientierung und Situationsorientierung gewinnt gegenüber dem Konzept der kognitiven Wissensvermittlung an Bedeutung. Ein wichtiger Aspekt ist die Veränderung und Erweiterung von Wissensproduktion (vgl. campus.vhs.at (2000): „Planungszelle versus Zukunftswerkstatt“).
Methoden der BürgerInnenbeteiligung haben gegenüber den verschiedenen Formen der Abstimmung, wie Wahlen, Volksentscheidungen und ähnlichem den Vorteil, dass nicht nur dafür oder dagegen entschieden wird. Die Alternativen sind nicht vorgegeben. Dies hat eine längerfristig prägende Wirkung auf die Beteiligten zur Folge (vgl. Dienel 1991: 75f).
„Die Planungszelle ist eine Anwendung der Vorteile des aufgabenorientierten, Lernen ermöglichenden Gruppenprozesses für die Zwecke der Planbeteiligung“ (Dienel 1991: 75).
In Planungszellen wie in Zukunftswerkstätten wird erlernt wie in einer Gruppe eine Entscheidung getroffen wird. Die Kommunikation ermöglicht Feedback, Überprüfung und Korrektur innerhalb der Gruppe und von jedem/jeder selbst. Probleme und Barrieren in der Gruppe müssen bewältigt werden. Dafür Kompromisse einzugehen und sich beim Überwinden von zum Beispiel Kommunikationsschwierigkeiten zu beteiligen kommt durch die Wertigkeit des gemeinsamen Ziels zustande. Einzelne nehmen sich selbst zum Wohle und zum Funktionieren der Gruppe zurück, diese Fähigkeit kann auf weitere Lebensbereiche übertragen werden.
Das Trennen der Phasen bringt ein Fokussieren mit sich. Indem zum Beispiel bei der Zukunftswerkstatt in der Kritikphase nur genannt wird was stört, kann niemand blockiert werden ein Problem zu nennen, weil es zu unlösbar oder zu unwichtig erscheint. Allgemein kann dieses Gliedern in Phasen auch im Alltag der Menschen strategisches Denken und geplantes Vorgehen fördern.
Bei beiden Modellen werden bewusst verschiedene Gruppen der Bevölkerung zusammengesucht. Das heißt es gibt auch immer einen sozialen und auch soziologischen Lernprozess. Die Menschen bekommen Sichtweisen, Kommunikationsweisen und Vorstellungen von Menschen, mit denen sie in ihrem Alltag eigentlich nichts zu tun haben, vor Augen geführt. In den Prozessen selbst wird direkt gelernt Kompromisse einzugehen und vielleicht neue Allianzen zu schließen, die dann zu Netzwerken ausgebaut werden können.
Sowohl Planungszelle als auch Zukunftswerkstatt haben bis zu einem gewissen Grad auch immer einen emanzipatorischen Effekt. Menschen erleben Politik als beeinflussbar. Sie beteiligen sich aktiv an politischen Prozessen, nehmen so Einfluss auf Entscheidungen und in gewissem Maße auch auf gesellschaftliche Vorgänge. Unter Umständen machen die Beteiligten im Rahmen einer Planungszelle oder einer Zukunftswerkstatt persönliche Bekanntschaft mit politischen EntscheidungsträgerInnen oder durchschauen Mechanismen und Strukturen der Politik. Die beteiligten BürgerInnen bekommen Selbstvertrauen im Bezug auf Autoritäten aber auch im Bezug auf sich. Beteiligten wird etwas zugetraut, es wird vermittelt, dass sie sich selbst etwas zutrauen können. Es wird quasi eingefordert, dass etwas erarbeitet wird und, dass die BürgerInnen dies können. Die beteiligten BürgerInnen müssen sich mit durchaus recht komplexen Sachverhalten beschäftigen und Hintergründe beleuchten oder nachforschen. Wer sich einmal diesen Umgang mit Komplexität angeeignet hat, wird im Alltag nicht mehr die oft allzu vereinfacht darstellenden Sichtweisen diverser Medien und anderer meinungsbildenden Institutionen und in der Öffentlichkeit stehender Personen hinnehmen.
Was natürlich auch einen nicht zu vernachlässigenden Bildungseffekt hat ist einfach, dass sich Menschen mit einem speziellen Thema beschäftigen. Sie erwerben ganz einfach Sachwissen. Dies passiert teilweise über relativ traditionelle Wege der Wissensvermittlung, zum Beispiel den Inputs der ExpertInnen in einer Planungszelle, über Austausch von Beteiligten und ihrem mitgebrachten Wissen, bis hin zum gezielten Phantasieren in der Zukunftswerkstatt.
Zusätzlich haben bürgerInnenbeteiligende Methoden einen Multiplikationseffekt. Erworbenes Sachwissen wird genauso wie Aspekte der angewandten Methode selbst an Menschen im Umfeld weitergegeben. Eingebundene sprechen mit Verwandten und Bekannten darüber und es entstehen daraus vielleicht weitere Diskussionen und Ideen. Die relativ kurze Dauer von Planungszelle beziehungsweise Zukunftswerkstatt schränkt natürlich ein. Bildung und auch politische Bildung erstreckt sich normalerweise über einen längeren Zeitraum, aber es werden jedenfalls fundamental wichtige Grundlagen angeeignet (vgl. partizipation.at o. J.: Planungszelle).
Literatur
Dienel, Peter C. (1991): Die Planungszelle. Der Bürger plant seine Umwelt. Eine Alternative zur Establishment-Demokratie. 2. Auflage. Opladen
Gruber, Elke (2008): Politische Bildung und Erwachsenenbildung – ein pädagogisch-struktureller Blick. Wien
Jungk, Robert (1981): Zukunftswerkstätten. Hamburg
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2000): Memorandum über Lebenslanges Lernen. Arbeitsdokument der Kommissionsstellen. Brüssel
Graue Literatur (Internetquellen)
campus.vhs.at (2000): „Planungszelle versus Zukunftswerkstatt“ oder ist „Politische Bildung“ politisch? Ein Gespräch zwischen Elke Gruber, Manfred Schindler und Peter Bettelheim.
Auf: http://projekte.vhs.at/partizipation/planungszelleversuszukunftswerkstatt
(zuletzt abgerufen am 5.1.2009)
partizipation.at (o. J.): Planungszelle. Auf: http://www.partizipation.at/planungszelle.html (zuletzt abgerufen am 5.2.2009)
Stadt Wien Marketing GmbH (2003): Wien. Zukunft findet Stadt. Bewegung findet Stadt. Dachverbände.
Auf: http://www.wien-event.at/bewegungFindetStadt/dachverbaende.cmi (zuletzt abgerufen am 6.1.2009)
>>> Politische Beteiligung und informelles Lernen
(download der Arbeit als .pdf)

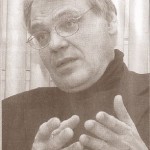
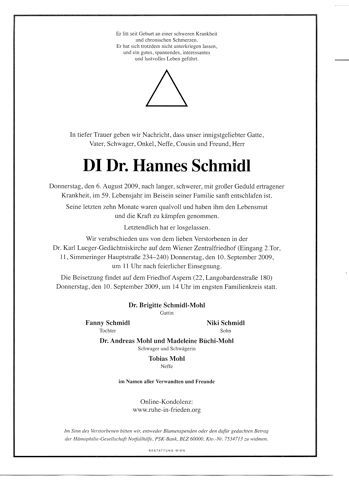
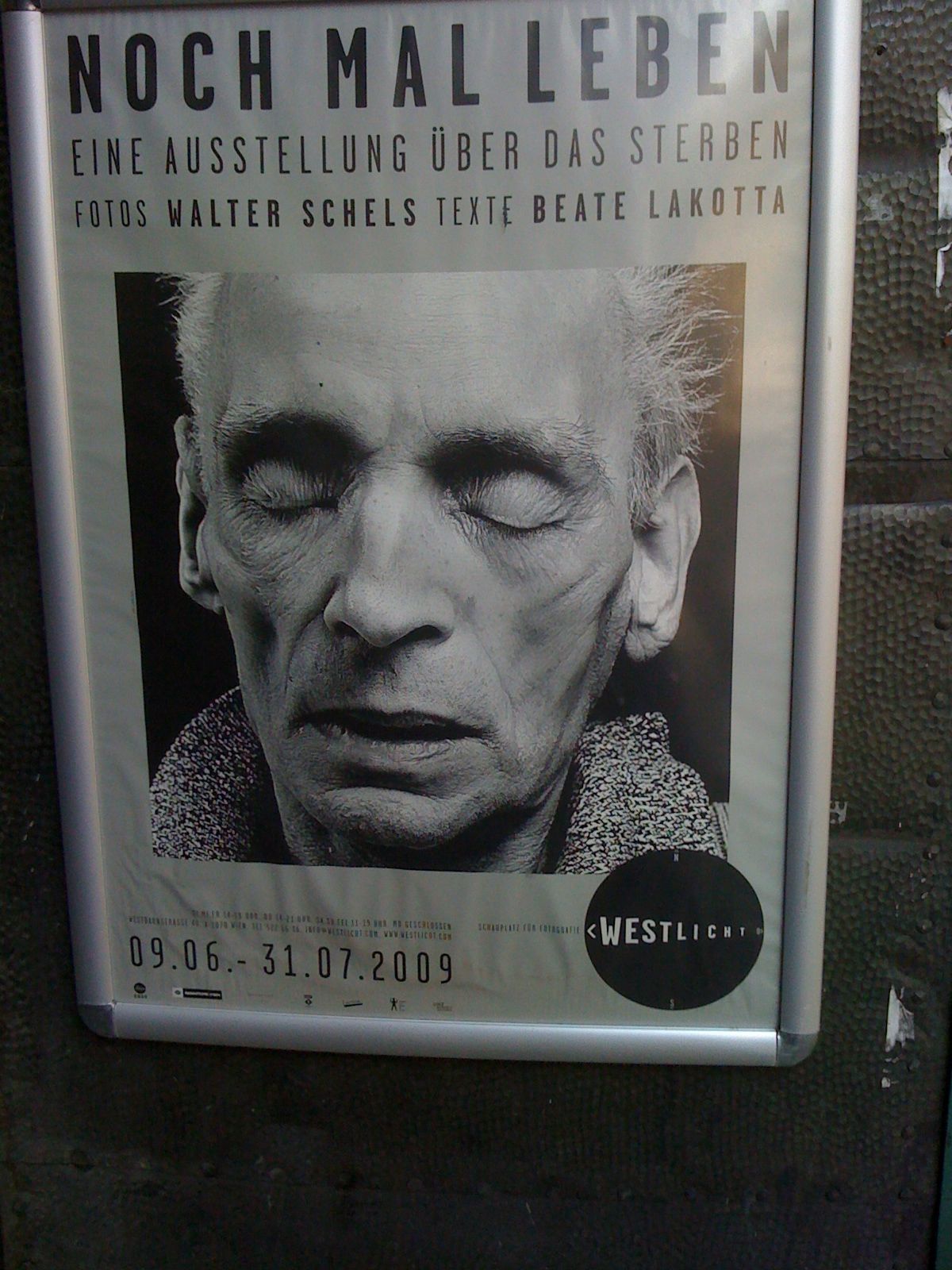
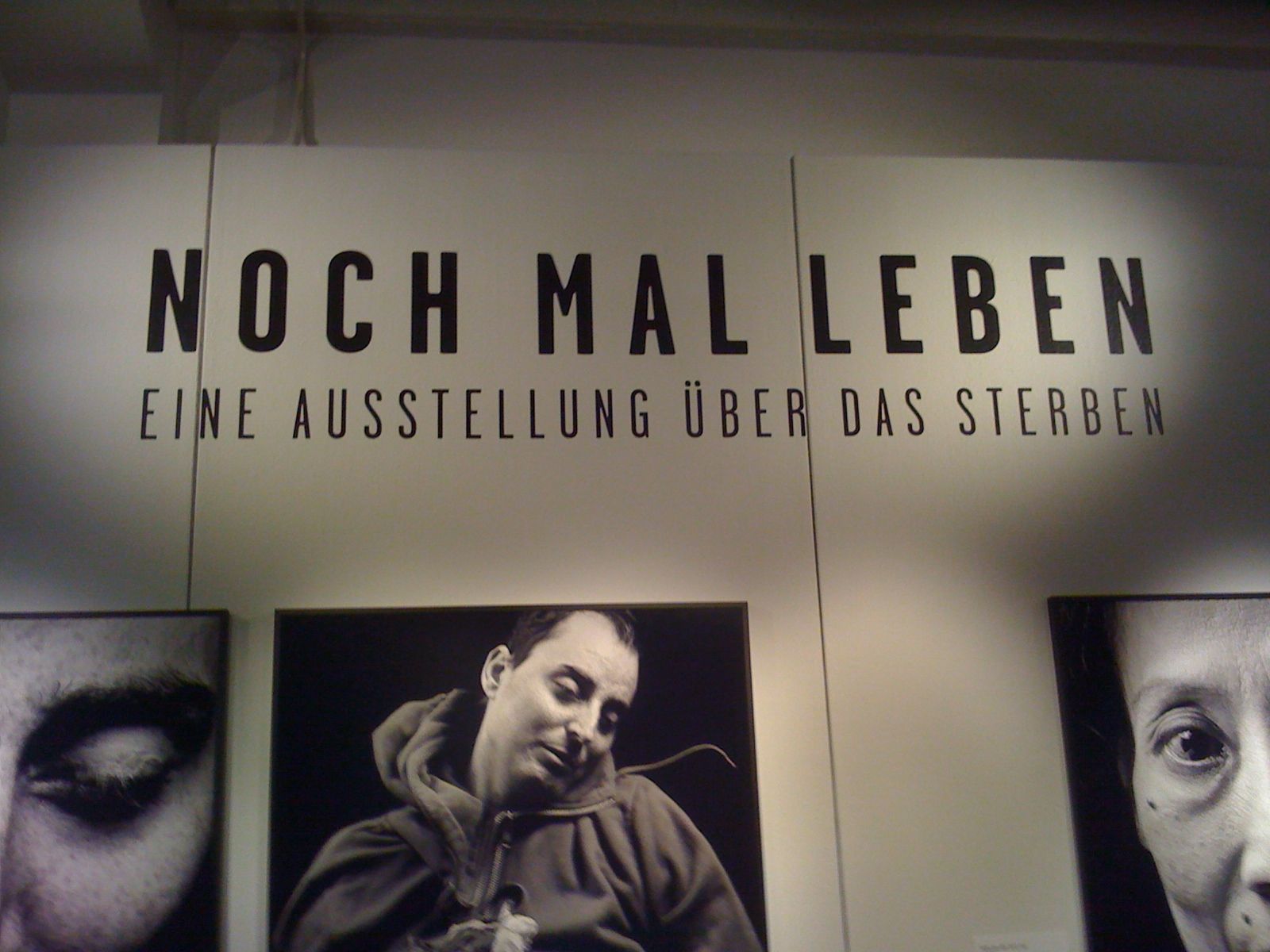

 Plan U-Bahn und S bahn in Wien von Horst Prillinger
Plan U-Bahn und S bahn in Wien von Horst Prillinger

